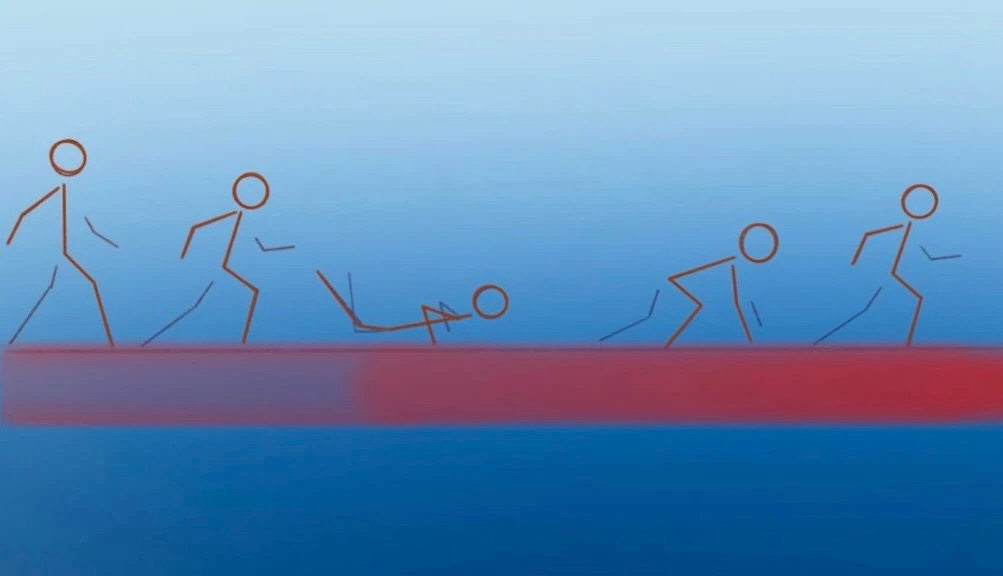Pflegekinder und FASD
An Pflegefamilien mit FASD-Kindern werden hohe Anforderungen gestellt. Ich möchte hierbei Adoptivfamilien nicht ausklammern, nur da wir eine Pflegefamilie sind, kenne ich mich mit diesem Bereich besser aus und beschreibe daher unsere Situation. Und natürlich möchte ich keine Herkunftsfamilie ausschließen. Da jedoch eine positive Entwicklung von Kindern mit FASD stark von einer stabilen und verlässlichen Umgebung abhängt und häufig ein förderliches Umfeld in den Herkunftsfamilien eher nicht gegeben ist, wachsen viele Kinder mit FASD in Pflege- oder Adoptionsfamilien auf.
Pflegekinder
Kinder fordern uns (heraus), Pflegekinder umso stärker. Pflegekinder bringen eine eigene Lebensgeschichte mit und diese ist oftmals, trotz der jungen Jahre, turbulent. Liebe und Geduld sind wesentliche Eckpfeiler in der Erziehung, nur das alleine reicht leider oftmals nicht aus. Pflegeeltern müssen sich ganz besonderen Herausforderungen stellen. Dazu gehört der Umgang mit den Besonderheiten in der Lebensgeschichte des Kindes, den Reaktionen der sozialen Umgebung und einer veränderten eigenen Familienkonstellation. Zudem ist die Aufnahme eines Pflegekindes mit einer Öffnung des privaten Bereichs in Bezug auf die Jugendhilfe bzw. anderer Träger sowie die Herkunftsfamilie verbunden.
Die Entscheidung, ein Pflegekind aufzunehmen, hat weitreichende Folgen für das Kind und die Familie. Sicherlich ist oftmals ein altruistischer Gedanke vorhanden – dem Kind ein besseres Zuhause bieten zu wollen und eine Chance auf ein besseres Leben. Dabei wird manchmal übersehen, dass Pflegekinder traumatisiert sein und Gewalterfahrungen durchlebt haben können. Es können Verhaltensstörungen auftreten oder auch psychische Störungen und Beeinträchtigungen jedweder Art sind bei Pflegekindern vermehrt vertreten.
Die Zahl der Pflegekinder steigt seit Jahrzehnten. Laut dem statistischen Bundesamt gab es 2010 ca. 60.500 Pflegekinder, im Jahr 2017 stieg die Zahl auf etwa 75.000 Kinder an. Im Durchschnitt verbleiben die Kinder 30 Monate in einer Pflegefamilie. U.U. kann das Kind, ist die Krise überstanden und das Kindeswohl gesichert, wieder in die Herkunftsfamilie zurückkehren. Genaue Zahlen dies bzgl. gibt es wenige. Es wird von ca. 10% zurückkehrender Kinder ausgegangen. Der Großteil der Kinder verbleibt damit im Pflegekindersystem.
Vor dem Hintergrund der steigenden Zahlen an Pflegekindern besteht eine Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der Thematik Pflegekind und FASD, eine durch den Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft verursachte, gravierende und lebenslange Beeinträchtigung.
80 Prozent der Kinder mit FASD werden aus den Herkunftsfamilien genommen, somit sei jedes vierte bis fünfte Pflegekind von FASD betroffen
Ca. 4.000 Kinder mit FAS werden jedes Jahr in Deutschland geboren, siehe hier auf unserer Webpräsenz: „Ausführliche medizinische Beschreibung – Häufigkeit von FASD“
Andere Quellen gehen von 2.000-4.000 Kindern aus (DLF „Schwangerschaft mit Vollrausch“; Merzenich & Lang 2002, Spohr 2014; DHS „Alkohol in der Schwangerschaft“; S.1)
Insgesamt wird mit ca. 10.000 Kindern mit FASD gerechnet, von denen viele nicht das Vollbild aufweisen, aber trotzdem ganz ähnliche Verhaltensweisen und Problematiken mit sich bringen (DLF „Schwangerschaft mit einem Vollrausch“).
Pflegekinder haben oft einen schwierigen Start
Pflegekinder weisen oft einen langen Leidensweg auf und hatten einen schwierigen Start ins Leben. Zudem müssen ungünstige prä– und postnatale Belastungsfaktoren abgeklärt werden. Das Neugeborene kann von seinen Eltern materiell und/oder emotional vernachlässigt und unzureichend gefördert worden sein. Die leibliche Mutter kann sich überfordert gefühlt und das Kind abgelehnt haben. Sie kann einer Mangelernährung ausgesetzt gewesen sein, bis hin zum Konsum von Alkohol, Tabak, Medikamente und/oder Drogen.
Symptome, die in der Schwangerschaft entwickelt werden können sind:
- Hirnschädigungen
- niedrigen Geburtsgewicht
- sowie bspw. eine Entzugssymptomatik
In der weiteren Entwicklung sind kognitive Beeinträchtigungen bis hin zur geistigen Behinderung, Verhaltensauffälligkeiten sowie Wachstums- und Entwicklungsverzögerungen oftmals zu beobachten.
Viele Pflegekinder erleben über Jahre hinweg Gewalt, Vernachlässigung und Misshandlungen – mit schwerwiegenden Folgen: so sind bei Pflegekinder im Vergleich zu Kindern aus „Normalfamilien“ häufiger psychopathologische [Glossar] Auffälligkeiten zu verzeichnen, wie z.B.:
- aggressives und delinquentes Verhalten
- Regelverletzung
- Verweigerung
- soziale Probleme
- motorische Unruhe
- hyperkinetische Störungen [Glossar]
- Konzentrationsschwierigkeiten
- Depressionen
- Ängstlichkeit
- Suizidversuche
Zudem weisen Pflegekinder häufig
- Posttraumatische Belastungsstörungen
- Entwicklungsrückstände
- ein negatives Selbstbild
- Lernprobleme
- Bindungsstörungen auf
Dreizig bis 60 Prozent der Pflegekinder haben behandlungsbedürftige psychische Störungen. Aufgrund der vielfältigen Problematik sind Pflegekinder einem höheren Risiko ausgesetzt, niedrige Schulabschlüsse zu erzielen und dysfunktionale [Glossar] Paar- und Familienbeziehungen zu führen.
Im Erwachsenenalter entwickeln sie häufiger Probleme in Richtung:
- Arbeitslosigkeit
- Substanzabhängigkeit
- psychische Erkrankungen
- delinquentes Verhalten
Siehe auch hier:
Artikel „Pflegekinder: Vielfältige Herausforderungen“ im Ärtzeblatt
Publikation der Drogenbeauftragten der Bundesregierung; S.5
Bindungsstörung
Viele Pflegekinder weisen eine Bindungsstörung auf. Eine sichere, emotionale Bindung ist für alle Menschen essentiell und gleichzusetzen mit der Notwendigkeit von Essen oder Atmen.
Bindung entsteht durch eine konstante, feinfühlige und aufmerksame Bezugsperson. Der Aufbau einer Bindung steht somit in KEINEM Verwandtschaftsgrad, d.h. ein Kind kann zu seinen Pflegeeltern durchaus eine sichere Beziehung aufbauen. Allerdings weisen viele Kinder, bevor sie zu ihren Pflegeeltern kommen, bereits tiefgreifende, negative Bindungserfahrungen und Beziehungsabbrüche auf. Die leiblichen Eltern haben häufig nicht angemessen, nicht schnell genug oder gar nicht, auf die Bedürfnisse ihrer Kinder reagiert. Gegebenenfalls waren ihre Reaktionen für die Kinder völlig unberechenbar und schwankten (z.B. durch den Einfluss von Alkohol, Drogen, psychischen Erkrankungen) zwischen einfühlsam, desinteressiert oder aggressiv. Die Kinder entwickeln eine desorganisierte Bindung und können das Gefühl von grundlegender Sicherheit nicht erleben. Zudem kommt, dass Pflegekinder häufig selbst im Pflegesystem wechseln und weitere Beziehungsabbrüche erleben.
Beispiel:
Tylar war nach seiner Geburt zunächst wegen seines Alkohol- und Drogenentzugs einige Wochen auf der Intensivstation. Er hat dann gemeinsam mit seiner Mutter in einer Mutter-Kind-Einrichtung gelebt. Auf Grund des weiteren Alkoholkonsums der Mutter wurde diese Maßnahme beendet und Tylar kam zu einer Bereitschaftspflegefamilie. Der Grundgedanke hierbei besteht in einer kurzfristigen Aufnahme eines Kindes, um das weitere Vorgehen abzuklären. Tylar lebte dort 1 1/2 Jahre und erlebte alleine durch die Länge seines Aufenthaltes einen erneuten Beziehungsabbruch als er zu uns kam. Damals war er gerade zwei, inzwischen lebt er seit fast 7 Jahren bei uns.
Pflegeeltern sollen eine emotionale Beziehung zu einem fremden Kind aufbauen. Alleine das ist eine schwierige Aufgabe, denn sie müssen sich diese Elternrolle mit der Herkunftsfamilie teilen. Oftmals findet weiterhin ein mehr oder weniger regelmäßiger Kontakt zu den leiblichen Eltern statt. Diese Besuchskontakte können sehr emotional besetzt sein, sowohl bei den Kindern als auch bei den leiblichen sowie den Pflegeeltern.
Pflegekind und FASD
Zu den Besonderheiten in Bezug auf das Zusammenleben mit einem Pflegekind, kommen im Alltag mit einem Pflegekind MIT FASD noch weitere zahlreiche Herausforderungen hinzu. Die extremen Verhaltensauffälligkeiten von Kindern mit FASD stellen enorm hohe Ansprüche an die Familien. Viele der Verhaltensweisen sind nur schwer auszuhalten. Kinder mit FASD benötigen viel Stabilität, Verlässlichkeit und Kontinuität. Die Bezugspersonen fungieren hierbei als „externes Gehirn“, die bei der Selbstregulation unterstützen, nicht Verstandenes übersetzen und in der sozialen Interaktion vermittelt. Es ist hilfreich, wenn die unterstützenden Personen ein fundiertes Wissen über die Beeinträchtigung aufweisen, allerdings ist den „meisten Ärzten, Hebammen, Psychologen oder auch den Mitarbeitern in dem Jugendämtern […] das Krankheitsbild samt seinen dramatischen Konsequenzen kaum bekannt.“ (DLF „Mit einem Vollrausch vom Gymnasium in die Hauptschule“). Laut einer Publikation des Landesjugendamtes Westfalen-Lippe (LVR/LWL-Landesjugendamt) aus dem Jahr 2017, liegt bei „den Kindern, für die Pflegeeltern gesucht werden, […] oftmals keine abgeschlossene FASD-Diagnostik vor“. Siehe hier (Vorwort): Fetale alkoholspektrum-störungen in der Praxis der Pflegekinderhilfe.
Allerdings wird davon ausgegangen, das bei „der Vermittlung eines Kindes mit FASD […] eine sorgfältige Aufklärung [notwendig ist]. Nur wenn die Bezugspersonen wissen, was sie eventuell erwarten kann, können sie sich […] vor Überforderung schützen. FASD wächst sich nicht durch […] Liebe aus!“ (Buch: FASD Angehörige, Betroffene, Fachleute; S. 47). ***
Die Realität sieht jedoch so aus, dass „sich nur wenige Pflegefamilien bewusst für die Aufnahme eines Kindes mit diesem Störungsbild“ entscheiden. Nachzulesen, auf Seite 16, in schon zuvor genannter Broschüre: Fetale alkoholspektrum-störungen in der Praxis der Pflegekinderhilfe
Diagnostik
Beispiel:
Auch unser Pflegesohn kam ohne Diagnose. Im gemeinsamen Zusammenleben wurde nach kürzester Zeit deutlich, dass etwas mit ihm „nicht stimmt“. Ein Termin im Sozialpädiatrischen Zentrum brachte Gewissheit. Bei Eintritt in den Behandlungsraum wurden wir mit den Worten: „Ach, da haben wir ja ein FAS-Kind!“ begrüßt. Sicher nicht die professionellste Möglichkeit einer Diagnosestellung oder Übermittlung. Nur wenn es bei unserem Kind rein äußerlich so offensichtlich war, wieso erfolgte im Vorfeld keine ergebnisorientierte Diagnostik durch das vermittelnde Jugendamt? Ein Kind ohne Diagnose ist sicher leichter vermittelbar und in aller Fairness muss ich sagen, dass wir eine Erziehungsstelle sind, mit pädagogischer Ausbildung für „schwierige“ Kinder. Für ein Kind mit Pflegegrad 3, einem GdB von 80 und lebenslang notwendiger Begleitung hätten wir uns jedoch gerne bewusst entschieden.
Auch wenn für uns die Diagnose eine Art Erleichterung darstellte, wird sie bis heute von einem Teil Trauerarbeit begleitet.
Eine frühe Diagnosestellung ist der erste Schritt und stellt einen schützenden Entwicklungsfaktor dar. Seit 2016 gibt es spezifische Richtlinien zur Diagnostik von FASD. Eine Diagnose kann für die Kinder und vor allem für ihr Umfeld eine wesentliche Entlastung darstellen. Denn die starken Auffälligkeiten der Kinder werden somit als Symptom ihrer Hirnschädigung und NICHT als Persönlichkeitsmerkmal oder als Erziehungsfehler angesehen. Ohne Diagnose werden Störungen im Sozialverhalten häufig nicht als Beeinträchtigung wahrgenommen, sondern als schlechte Angewohnheit oder Erziehungsversagen. Zudem stellt die richtige Diagnose die Voraussetzung für die Einleitung von Therapiemaßnahmen dar (DHS „Alkohol in der Schwangerschaft“; S.19).
Jedoch wird die Diagnostik erschwert, da bei vielen Kinder in Pflegefamilien der Alkoholkonsum der leiblichen Mutter während der Schwangerschaft nicht bekannt ist. Einige typische äußere Symptome und Ausprägungen werden im Jugend- bzw. im Erwachsenenalter weniger sichtbar, daher ist es entscheidend, bereits Kleinkinder zu diagnostizieren (Spohr & Steinhausen, 2008; DHS; „Alkohol in der Schwangerschaft“; S. 10).
Beispiel:
Tylars leibliche Mutter hat während der gesamten Schwangerschaft Alkohol konsumiert und war im Methadonprogramm. Sein leiblicher Vater hat ebenfalls Alkohol und Drogen konsumiert. Diese Informationen erhielten wir nach Tylars Aufnahme bei uns und auf direkte Nachfrage im Zuge der durchgeführten Diagnostik.
Der Mutterpass der leiblichen Mutter liegt uns nicht vor, ggf. ist dort ein Hinweis auf eine Alkohol- und Drogenabhängigkeit ihrerseits enthalten. In Tylars U-Heft sowie im Abschlussbericht der Klinik befindet sich ein Vermerk bzgl. eines „neonatalen Entzugssyndroms“ [Glossar] auf Grund der Substitution [Glossar] der leiblichen Mutter. Eine Alkoholabhängigkeit der leiblichen Mutter ist nicht vermerkt.
Alltag
Das Zusammenleben mit Menschen mit FASD erfordert eine strukturierte Begleitung mit sehr vielen Routinen, die ständig wieder eingeübt werden müssen. Eine rund-um-die-Uhr Betreuung ist zumeist auf Grund der fehlenden Fähigkeit aus Erfahrungen zu lernen und das eigene Verhalten zu lenken, notwendig. Von der Umwelt werden Familien mit FASD-Kindern oftmals als überbehütend oder auf Grund der notwendigen, engen Regeln als einschränkend angesehen. Selbst Fachkräfte in Kindergärten, Schulen oder Ärzte hören leider bei den Erklärungen das Kind betreffend oft nicht zu. „Das Wissen um das Störungsbild in der Gesellschaft [ist] bislang nur rudimentär vorhanden“ (LVR/LWL-Landesjugendamt (2017) Fetale Alkoholspektrum-Störung in der Praxis der Pflegekinderhilfe, S. 8; Fetale alkoholspektrum-störungen in der Praxis der Pflegekinderhilfe eine gemeinsame arbeitshilfe der landesjugendämter rheinland und Westfalen).
Obwohl Kinder und Jugendliche mit FASD oftmals recht pfiffig wirken, da sie zumeist gute verbale Fähigkeiten aufweisen, erfassen sie die Gesprächsinhalte nicht und können Gelerntes nicht abrufen. Somit können „80 Prozent der alkoholgeschädigten Kinder […] als Erwachsene nicht selbständig leben.“ (DLF:Mit einem Vollrausch vom Gymnasium in die Hauptschule).
Damit sind Pflegeeltern einer ständigen Überlastung ausgesetzt und stoßen in ihrem sozialen Umfeld oft auf Unverständnis [soziale Isolation]. Pflegeeltern sollten die Möglichkeit haben, ihre Energiereserven wieder aufzutanken und zu erhalten: Mehr dazu auf dieser Seite unserer Webpräsenz. Sie stehen ständig „unter Strom“ und sind langfristig einer enormen Belastung ausgesetzt. Pflegeeltern sind die wichtigsten Anker im Leben der Kinder und nur wenn sie stabil, belastbar und zufrieden sind, können sie ihren Kindern langfristig eine gute Unterstützung bieten. Selbstverständlich gibt es Unterstützungsangebote wie Beratungen, Supervisionen, Austausch mit Betroffenen, Fortbildungen oder auch finanzielle Unterstützung, um Entlastungswochenenden oder eine Auszeit ohne Kind realisieren zu können. Der Weg dorthin ist jedoch sehr steinig…